Frauen-Zauber-Frauen
Frauen-Zauber-Frauen, 2009
für Sopran, Tenor/Altus, Querflöte/Blockflöte/Alt, Harfe, Cello (2009)
Text: Walter Studer
1. Riverenza (2m)
2. Göttin (4m30)
3. Drei-Frauen-Zauber (3m)
4. Ringelsocke (3m)
5. Kuchengenesis (4m30)
6. Brot des Lebens (5m)
7. Tänzer (7m)
8. Aion I (6m30)
9. Aion II (2m30)
Uraufführung
7. 3. 2010, Brig-Glis, Zeughaus Kultur
Mitwirkende:
Eva Nievergelt, Sopran
Javier Hagen, Tenor/Altus
Isabelle Gichtbrock, Querflöte/Blockflöte/Alt
Isabelle Steinbrüchel, Harfe
Moritz Müllenbach, Violoncello
Paul Wegman Taylor, Leitung
Weitere wichtige Aufführungen:
11. 3. 2010, Zürich, Tonhalle, Kleiner Saal, Rezital
16. 12. 2010, St. Gallen, Tonhalle, contrapunkt new art music
17. 12. 2010, Winterthur, Theater am Gleis, musica aperta
Gesamtdauer
40m
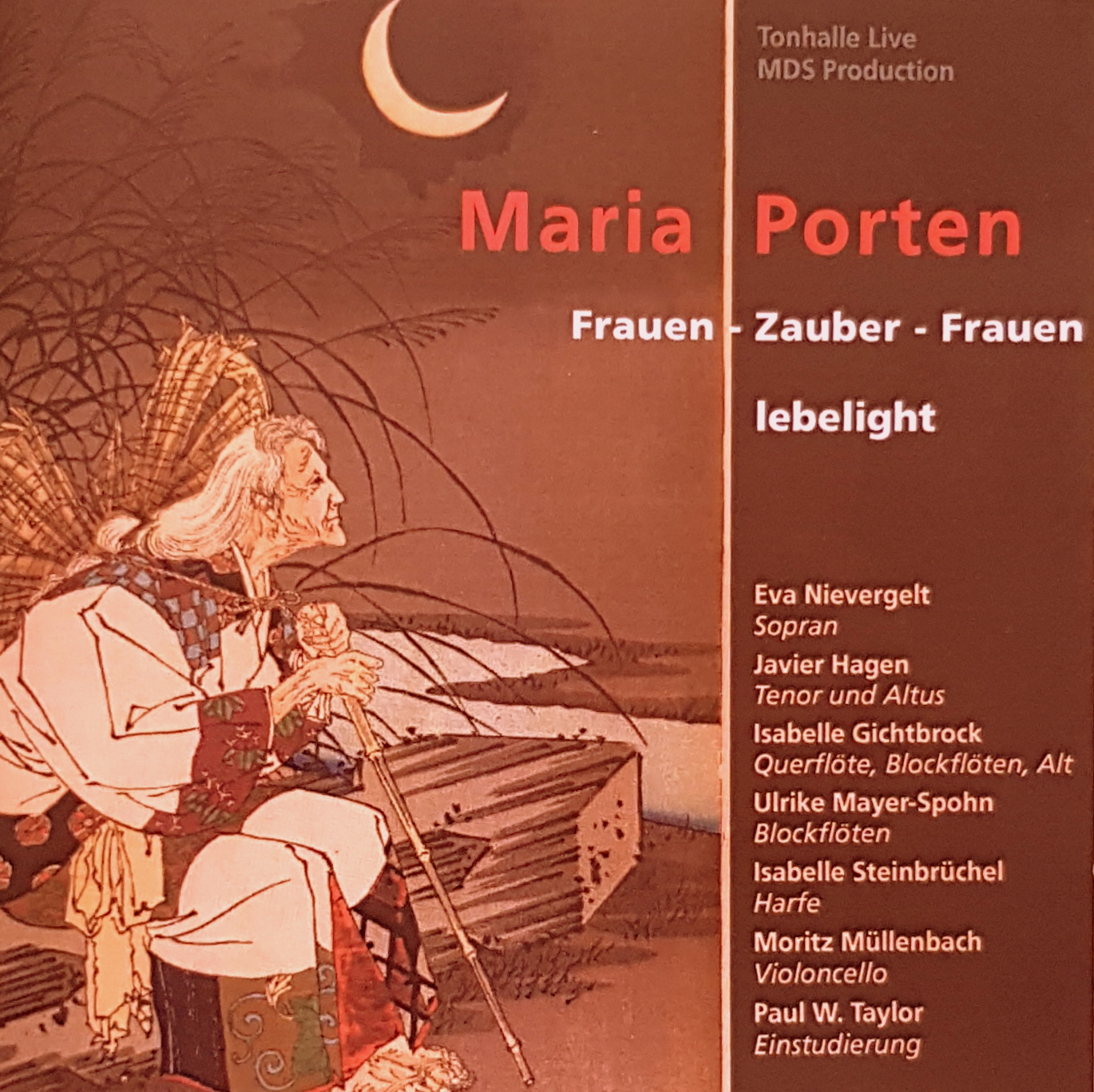
CD-Einspielung
Maria Porten - Frauen-Zauber-Frauen
MDS Production
Mitwirkende:
Eva Nievergelt, Sopran
Javier Hagen, Tenor/Altus
Isabelle Gichtbrock, Querflöte/Blockflöte/Alt
Isabelle Steinbrüchel, Harfe
Moritz Müllenbach, Violoncello
Paul Wegman Taylor, Leitung
Werkkommentar
Riverenza. Wie bei Shakespeare dem
Publikum die Ehre geben! Die Flötistin steht plötzlich
allein mitten auf der Bühne, spielt mit wenigen Takten
Musik Motive an, die im folgenden Programm thematisiert
werden und spricht schliesslich einen aus dem Irgendwo
kommenden Text - die letzte Strophe des Gedichts "Zeichen
für Miriam" von Walter Studer.
Göttin. Anders als in der offiziellen
christlich-jüdischen Schöpfungsgeschichte sind hier
Göttinen am Werk und sie - nicht die
religionsgeschichtlich viel jüngeren männlichen Gottheiten
- sind die Mittlerinnen des Heils. Dem kurz-prägnanten,
beschwörenden Text entsprechend, beschränkt sich die Musik
auf wenige musikalische Gesten.
Drei-Frauen-Zauber. Kulte von
den drei heiligen, hexenhaft-hilfreichen, oft
verführerischen Zauberfrauen kannte die antike und
vorantike, aber auch die christliche Welt. Sie haben
gewichtige Spuren hinterlassen, die hier in einer Art
lyrischem Zauberspruch manifest werden. Um das Element der
Dreiheit in "Drei-Frauen-Zauber" zu unterstreichen, singt
die Flötistin in diesem Stück die Altstimme. Tragendes
Element sind drei Klänge in Variation. Sie beruhen auf dem
Haussegen C+M+B+: Christus Mansionem Benedicat, der
wahrscheinlich auf einen Drei-Frauen-Zauber zurückgeht.
Ringelsocke. Eine heisse Ferienliebe
auf den berühmten ersten Blick taucht aus der Erinnerung
und einem musikalisch impressionistischem Wirrwarr empor.
Dem leisen Schmunzeln folgt die jäh wieder belebte tiefe
Sehnsucht.
Kuchengenesis. Die Welt wurde in
sechs Tagen (plus einem Ruhetag) erschaffen. Das
vorliegende Gedicht weiss es besser: Am 8. Tag schuf Gott
die Liebe und am 9. Tag, auf den Vorschlag eines Kindes,
den Kuchen - und das Lachen gleich mit. Das märchenhafte
Stück kommt einfach und leichtfüssig daher, so, wie man
einem Kind vom lieben Gott erzählt. Dieser Charakter wird
musikalisch durchgängig aufrecht erhalten.
Brot des Lebens. Das Stück
schildert die zunehmende Enttäuschung Gottes über sein
wohl wissendes, aber im Verhlaten unbelehrbares Geschöpf:
Erwägt Gott zunächst noch ein weiteres Opfer, bereut er
mit der Zeit, als er "älter" wird, die Offenbarung,
verachtet den Menschen und vergisst ihn schliesslich.
Damit ist dem Menschen die Gnade entzogen und er geht dem
sichern Untergang entgegen. Der im Text nur als Objekt
genannte Mensch tritt musikalisch schmerzhaft direkt in
Erscheinung. Die Musik schafft zewei deutlich
unterschiedene, aber ineinander überführende Ebenene: Die
ferne Ebene Gottes, dargestellt vom Tenor in der
Altuslage, begleitet vom Cello und unterstützt von der
Harfe; und die laute, schnelle, chaotisch-haltlose Ebene
des Menschen. Meist braucht es ein "Machtwort" der Harfe,
um den Lärm abzustellen.
Tänzer. In diesem Gedicht offenbart
sich der Tänzer als Tod - oder der Tod als Tänzer. (Der
Tod ist hier weiblich wie in den romanischen Sprachen.)
Das streng eingehaltene hexametrische Versmass ist
rhythmisch beschwingt, endet aber abrupt und
unbefriedigend. In diese Karussell aus Singen und
Sprechen, in dem wechselweise geckig - spöttisch -
ironisch - freundlich - augenzwinkernde Tänzer nur
vordergründig das Heft in der Hand hält, kommt kein Pathos
auf. Die vier Strophen enden jeweils in einem tröstlichen
(oder höhnischen?) Refrain, der den Hexameter verlässt. Wo
bleibt der Mensch? Die irritierte, panische Cellostimme
gibt ihm als dem benötigten Tanzpartner Ausdruck. Mit dem
Hinzutreten der Harfe in der 3. Strophe schieben sich
bekannte Bilder vom Tod ein wie das stark verfremdete alte
Volkslied "Es ist ein Schnitter, heisst der Tod". Sie
werden aber als "blind" dargestellt.
Aion I und II. Verschwindet der Mensch
in der Unermesslichkeit eines erinnerungs- und
bedeutungslosen Nichts? Nein! Aion I symbolisiert eine
Überwirklichkeit - das ist die Zuversicht des Mystikers -
in der alles Sein und Tun unvergessene Wirkung ist. Die
fragile Musik von Aion I macht uns in acht Mal sieben
langsamen 7/4-Takten das fast unmerkliche Vergehen der
Zeit erfahrbar, aber auch die Kondensation von Erlebtem,
wie sie, nach alttestamentarischer Vorstellung, auf der
Rückseite des Vorhangs im Tempel zu lesen ist. Aion II ist
das musikalische Gewahrwerden des Vergangenen - die
Ringelsocke taucht ebenso auf wie der Tod - und verspricht
in einem kraftvollen Abschluss des ganzen Zyklus einen
neuen Anfang.
(M. Porten)
Partitur ZU ERGÄNZEN
Nr. 1 Riverenza, Livemitschnitt
Nr. 2 Göttin, Livemitschnitt
Nr. 3 Drei-Frauen-Zauber, Livemitschnitt
Nr. 4 Ringelsocke, Livemitschnitt
Nr. 5 Kuchengenesis, Livemitschnitt
Nr. 6 Das Brot des Lebens, Livemitschnitt
Nr. 7 Tänzer, Livemitschnitt
Nr. 8 Aion I, Livemitschnitt
Nr. 9 Aion II, Livemitschnitt
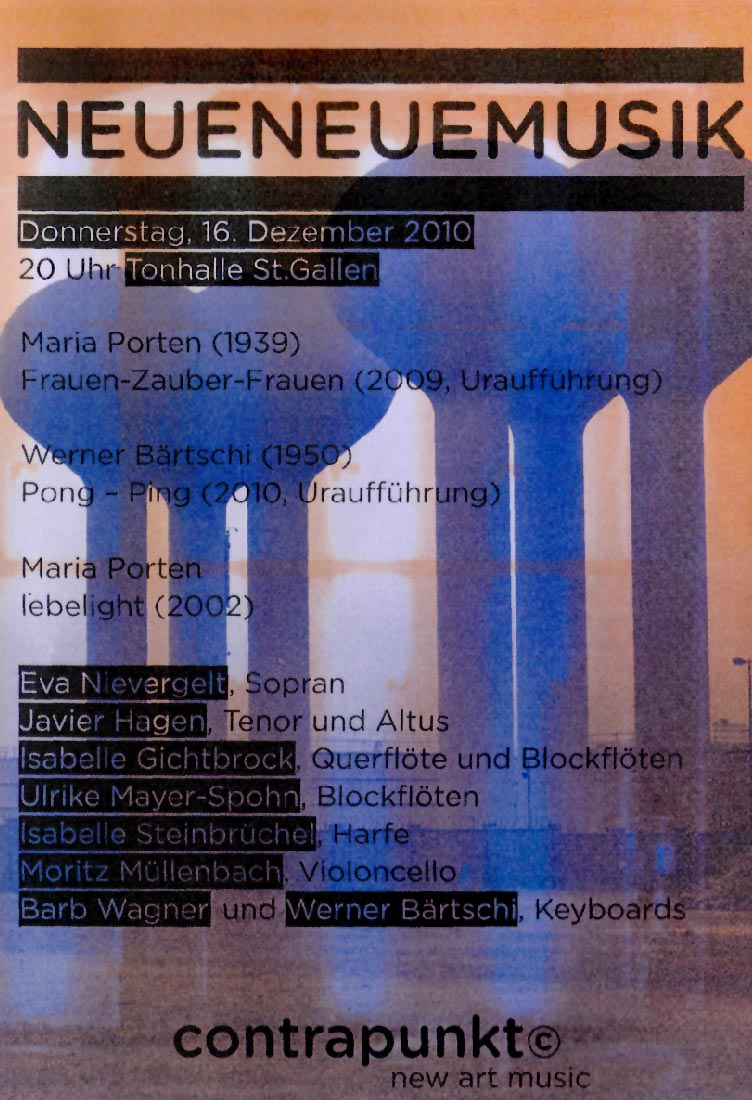
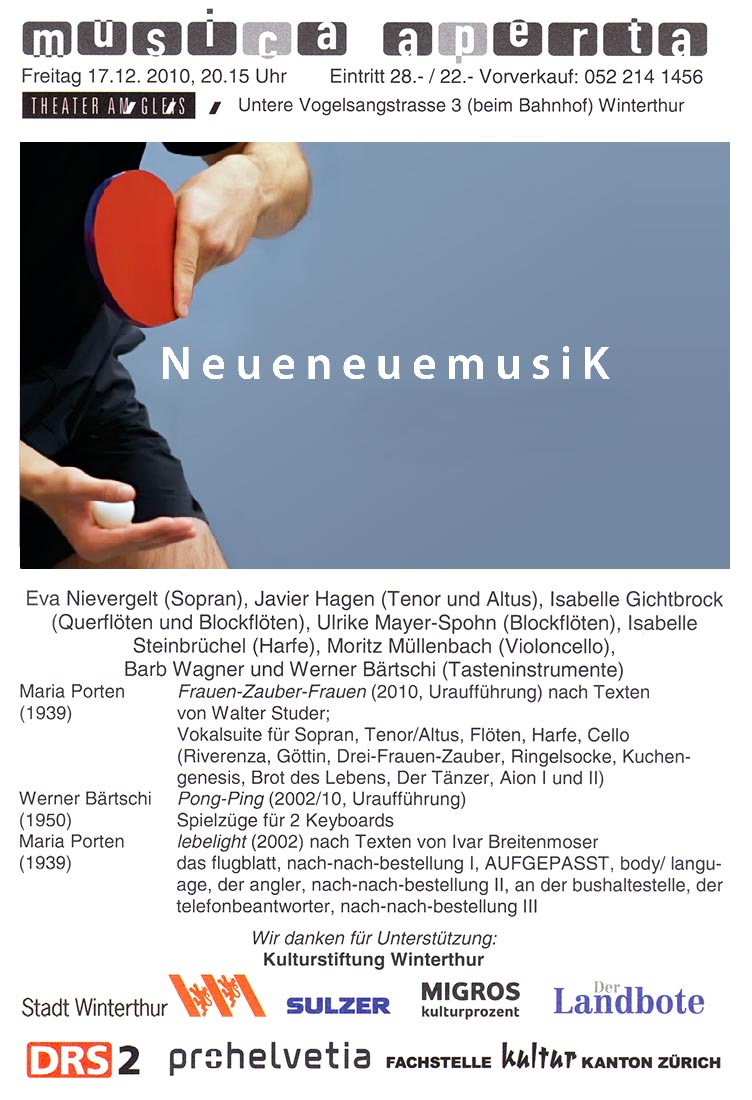
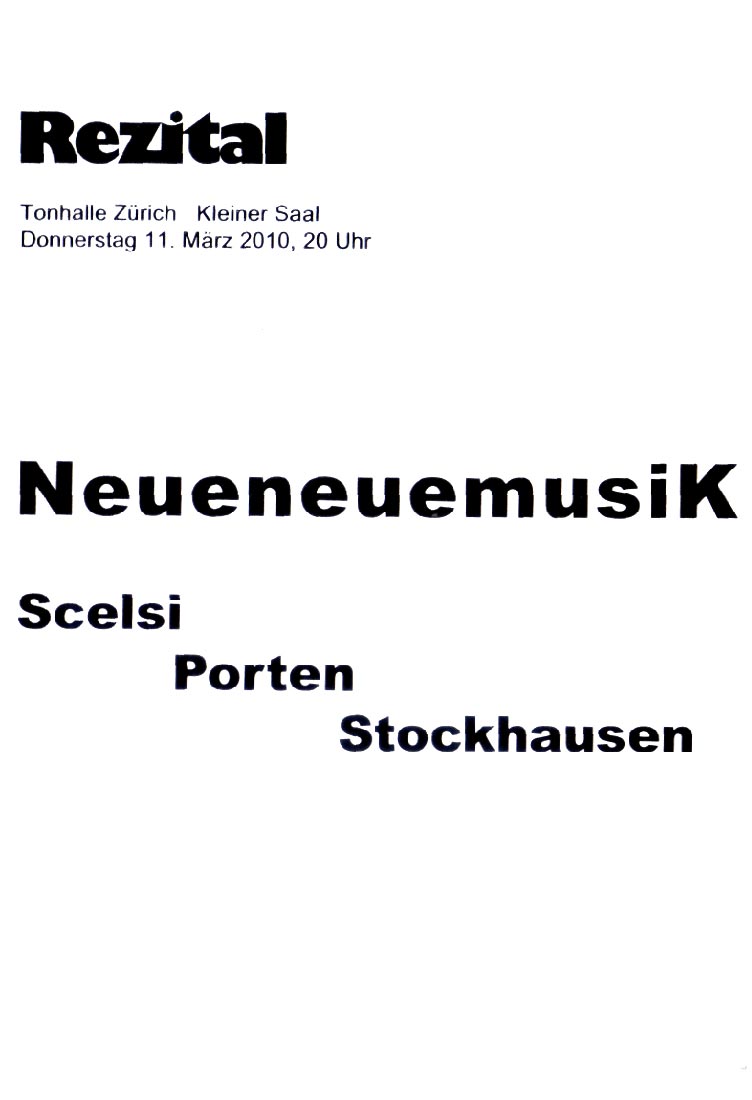
Umschlagbilder des Programmhefte der Uraufführungsreihe

Kritik des Konzertes in der Tonhalle Zürich (Rezital) vom 11.3.2010