Lamento
Lamento, 2007
für Bariton, Streichquartett, 2 Blockflöten (2007)
Text: Remco Campert
Uraufführung
21. 9. 2007, Zürich, Wasserkirche, "Ferne Schritte. Nähe"
Mitwirkende:
Michael Mrosek, Bariton
Ulrike Mayer-Spohn, Blockflöten
Isabelle Gichtbrock, Blockflöten
Garcia Abril Quartett
Dauer
7m30
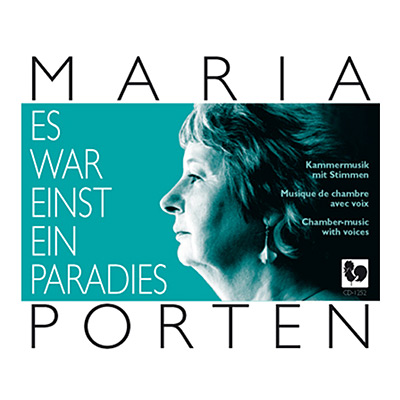
CD-Einspielung
Maria Porten - Es war einst ein Paradies
VDE Gallo CD 1252
Mitwirkende:
Michael Mrosek, Bariton
Ulrike Mayer-Spohn, Blockflöten
Isabelle Gichtbrock, Blockflöten
European String Quartet
Paul W. Taylor, Leitung
Werkkommentar
Remco Campert
schildert in seinem Gedicht Lamento einen Menschen, der
glaubt, man könne immer einfach nur so weiter gehen: am
langen, tiefen Wasser entlang, am Uferschilf, hinter dem die
Sonne hervor scheint, am sich kräuselnden Wasser vorbei; im
Nachmittagslicht eines reglosen, blauen Sommerhimmels; mit
Augen, die vor Glück brechen, während der Schrei vom Himmel
hängt. Der Mann hätte nie gedacht, dass Frost kommen,
Eis das Wasser bedecken und Schnee auf die Zypressen fallen
könnte, dass sie nie mehr...
Hier hört das Gedicht auf. Eine besondere Schwierigkeit für
das Verständnis des Gedichtes besteht darin, dass das
holländische „je“ wie auch das deutsche „du“ sowohl ein
konkretes Gegenüber als auch ein verallgemeinerndes „man“,
das den Sprecher selbst mit einschließt, bezeichnen
kann. Ist „ik“ in diesem Gedicht ein Mann und „je“ seine
Geliebte? Wahrscheinlich ja, vielleicht aber auch nicht. Und
die „vor Glück brechende Augen“? Wir assoziieren mit
brechenden Augen spontan zunächst den Tod. In diesem Fall
wäre der Schrei vielleicht ein Todesschrei, und das Du,
sofern es eins gegeben hätte, wäre am Schluss tot und würde
betrauert. Lamento! Es gibt aber noch eine ganz andere
Deutung: im Französischen wird der Moment höchster
Liebesekstase auch als „le petit mort“ bezeichnet.
„Vor Glück“ brechende Augen - das wäre so wieder zu
verstehen, der Schrei wäre ein Lustschrei, und der Frost
erschiene als ein Symbol für die erkaltete Liebe, in der es
nur noch ein „nie mehr“ gibt. Lamento auch hier. Das
Gedicht gibt uns keine Verständnishilfe durch eine
Syntax. Es lässt uns schwingen in Kreisen von wiederholten
Bildern und Vorstellungen. Zunächst erscheint die Reihung
sehr willkürlich; aber wenn man sich mittragen lässt, merkt
man, dass die Statik des Anfangs von der „lebenden“ Stille
des Mittelteils überlagert wird. Die hellen Bilder mehren
sich, kulminieren, nehmen wieder ab, um, nach einer kurzen
Erinnerung, in der Kälte zu erstarren.
Auch ich als
Komponistin folge den sich belebenden und dann ersterbenden
Gefühlen. Ich überlasse dem Dichter das Zepter und begnüge
mich bei meiner Vertonung mit wenigen Mitteln: Der Sänger
hat nur sechs Töne (plus Oktave) zur Verfügung. Seine
Notenlängen entsprechen in leichten Varianten dem Rhythmus
des Textes. Er singt ein manchmal gehobenes Parlando. Nur
beim Einbruch des Frostes versagt ihm die Stimme. Die beiden
Flöten unterstützen sein Empfinden mit rhythmischen Akzenten
und melodischen Elementen. Die Großbassflöte wird vor allem
am Schluss mit ihren seltsamen Multiphonics wichtig. Das
Streichquartett schildert auf fast impressionistische
Manier die Natur mit stehenden oder flimmernden Klängen. Da
die Natur aber auch die Emotionen der Menschen spiegelt,
verstärken die Streicher zudem die Stimme des Sängers, indem
sie seine Linien verdoppeln, sie mit einer Parallelstimme
„unter-“ oder „über-“malen oder sie in wenigen Fällen
auch kontrapunktieren. Bei allen Instrumenten und auch beim
Bariton sind die Klangfarben wichtig. Das ganze Stück ist
ruhig und sehr leise. Formal besteht die Vertonung aus
lauter Fünftaktgruppen plus Vorspiel und Nachspiel.
(M. Porten)
Partitur ZU ERGÄNZEN
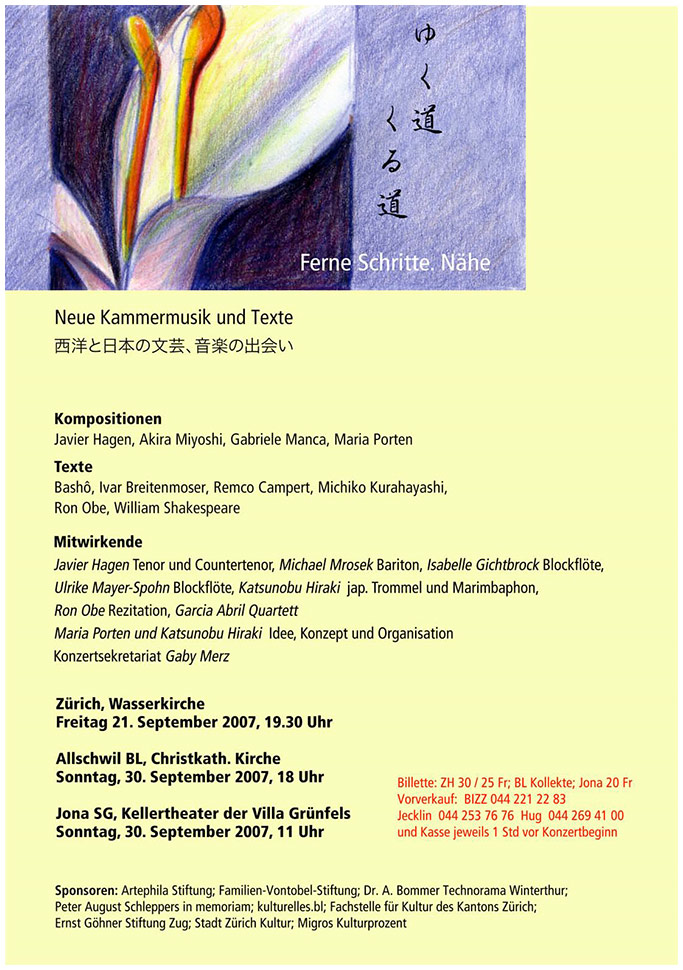
Umschlagbild des Programmhefts der Uraufführung (Ferne Schritte. Nähe)
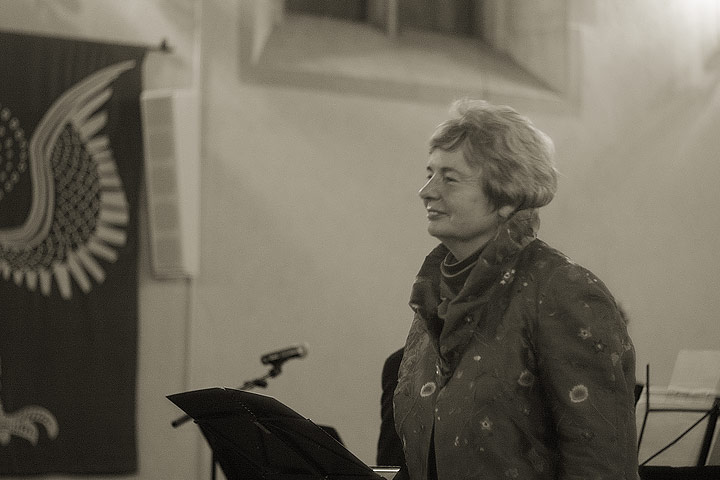


Impressionen vom Uraufführungskonzert "Ferne Schritte. Nähe", Zürich, Wasserkirche, 9/2007






Impressionen von den Aufnahmesessions
im Aufnahmestudio des Schweizer Radios DRS in Zürich
06/2008