11. Juli 1995 -
Srebrenica
11. Juli 1995 - Srebrenica 2003
für Vokalquartett SATB, Blfl, Vle, Vc, Perc (Vib, kl.Tr), Elektronik (2003)
Text: Behaudin Trakic / Maria Porten
Uraufführung
30. 8. 2003 Zürich Wollishofen, Kirchgemeindehaus
mit Claudia Dieterle (S), Eva Nievergelt (A)
Javier Hagen (T), Norbert Günther (B)
Astrid Knöchlein (Blfl), David Newman (Vl)
Edit Hajdu-Irmay (Vc), Katsunobu Hiraki (Perc)
Pius Morger (El), Jürg Henneberger (Ltg)
Wichtige Folgeaufführungen
11. 7. 2005, Zürich, ETH Zentrum, Semper-Aula,
zum 10jährigen Gedenken an das Srebrenica-Massaker
mit Claudia Dieterle (S), Andrea del Favero (A)
Javier Hagen (T), Ruben Drole (B)
Isabelle Gichtbrock (Blfl), Deborah Furrer (Vl)
Edit Hajdu-Irmay (Vc), Katsunobu Hiraki (Perc)
Pius Morger (El), Jürg Henneberger (Ltg)
Dauer
15m
Werkkommentare
Acht Jahre danach. Am 11. 7.2003 trafen sich Tausende von Muslimen auf dem im Entstehen begriffenen Friedhof von Potocari und beerdigten einige neu identifizierte Opfer des Massakers von Srebrenica. (Von 5 000 der 7 000 Opfer wurden sterbliche Überreste in Massengräbern gefunden, 1 620 davon sind bis jetzt identifiziert und beigesetzt. 2 000 Menschen gelten noch immer als vermisst.)
Indessen arbeitet die Chefanklägerin des Uno-Tribunals in Den Haag, Carla Del Ponte,daran, dass die Urheber der Gräueltaten festgenommen, überführt und verurteilt werden. Zwei der wichtigsten Verantwortlichen für das bestialische Morden in Srebrenica sind noch auf freiem Fuß: Karadzic und Mladic. Der erste ist für viele Serben ein Held, der zweite wird durch das Militär gedeckt, so heißt es. Carla Del Ponte hofft, dass die Situation sich ändern wird. Die Regierungen können es sich auf die Dauer nicht leisten, Kriegsverbrecher in ihrem Land zu dulden, und sie haben eingesehen, dass kein Weg nach Europa an Den Haag vorbeiführt. "Ich habe den Frauen von Srebrenica erklärt, dass wir nicht nachgeben werden. Für die Opfer ist es wichtig zu wissen, dass es jemanden gibt, der nicht aufgibt. Für die Opfer sind wir ein Symbol der Gerechtigkeit. Dies gibt ihnen die Kraft, weiter zu leben und weiter zu kämpfen." Sei es dank dieser Unterstützung durch die Chefanklägerin, sei es dank der deutschen Frauenorganisation Amica, die half Traumata zu verarbeiten, oder sei es kraft eines intensiven Wunsches, das Land wieder auf menschenwürdige Weise bewohnen zu können: Musliminnen und Serbinnen versuchen, den schwierigen Prozess der Versöhnung anzugehen.
"Zuerst schrieben wir uns Briefe, dann telefonierten wir miteinander, und schließlich trafen wir uns, aber zu Beginn nur heimlich, an geschützten Orten. Wir wurden von der Bevölkerung hier beschimpft und verlacht. Es brauchte viel Beharrlichkeit; aber inzwischen wird unsere Arbeit hier geschätzt."
(zitiert nach Auszügen aus: Milosevic gerät vor dem Uno-Tribunal in Bedrängnis, 10.7.03, NZZ; Die Frauen von Srebrenica setzen Zeichen der Versöhnung, 13.7.03, SonntagsZeitung; Ewige Suche nach Radovan Karadzic, 13.7.03 NZZ am Sonntag; Interview mit Carla Del Ponte, 18.7.03 NZZ)
Das Stück schildert die Ankunft von Flüchtlingen, die gerade das Massaker von Srebrenica haben miterleben müssen. Um das Furchtbare für den Zuhörer nachvollziehbar zu machen, wird es textlich in einen historischen Zusammenhang gestellt und musikalisch in distanziertem Stil und klassischer Form zum Ausdruck gebracht. Ein wichtiger, sich simultan entwickelnder Raum für die Kompositionen von Maria Porten wird von Pius Morger durch das Hinzutreten der Elektronik/Zuspielbänder geöffnet. In 11.Juli 1995 werden die unvermeidlichen Journalisten nicht mit Worten oder Musik beschrieben, sondern durch "Blitzlichtgewitter", einen Sound, der allen Fernsehzuschauern bestens bekannt ist. Beim Einspielen einer Volksliedmelodie meldet Bekanntes sich zu Wort und wird doch zugleich in unerreichbare Ferne gerückt.
M. PortenSrebrenica. Als
der bosnisch-serbische Krieg (1992 - 1995) begann, war
Srebrenica. eine vorwiegend muslimische
Achttausend-Seelen-Stadt im Osten von Bosnien. Bei der
Eroberung Ostbosniens durch die Serben blieb Srebrenica
als "Kriegsenclave" in bosnischer Hand. Im
Frühjahr 1993 wurde Srebrenica unter Unomandat gestellt
und zur Schutzzone erklärt, d.h die Bürger der Stadt
wurden aufgefordert, ihre Waffen abzugeben, und die
Unprofor garantierte ihnen Schutz. In dieser Zeit kamen
viele muslimische Flüchtlinge aus dem besetzten
Ostbosnien in die geschützte Stadt, und die Zahl der
Bewohner wuchs auf mehr als 40 000. Die
Serben erkannten die Unoresulution nicht an und
versuchten Srebrenica zu erobern. Ungefähr einen Monat
hielten paramilitärische serbische Gruppen, deren
Anführer (z.B. Arkan, Mladic', Karadzic') man aus dem
Kriegsverbrecher-Tribunal in Den Haag kennt, die Stadt
mit schwerem Kriegsgerät umzingelt. Die Uno reagierte
zwar mit Protestnoten, ihre Soldaten griffen aber, trotz
vieler Warnungen und der Angst der Bevölkerung vor
Gewalttaten, militärisch nicht ein. Am 11. Juli gelang
den Serben die Einnahme von Srebrenica. Unter den Augen
der Uno- Soldaten fand ein furchtbares Morden statt. Die
Serben trieben alle Bewohner nach Potocari, einem Vorort
von Srebrenica. Sie trennten die jungen Frauen und
Männer (12-65 Jährige) von den älteren Menschen und den
Müttern mit Kindern. Die Alten und die Kinder wurden in
Bussen und auf Lastwagen nach Tusla geschickt, die
jungen Frauen wurden vergewaltigt und umgebracht, die
jungen Männer bestialisch niedergemetzelt. Viele
Tausende starben in Potocari. Mindestens 7 000 Männer
flohen in die Wälder der Umgebung. Bei der Hatz, die die
Serben auf sie veranstalteten, erreichte nur etwa einer
von fünfzig freies Terretorium. Noch heute sind viele
von ihnen vermisst. Immer wieder werden Massengräber
entdeckt und Tote identifiziert. Srebrenica und
Ostbosnien gehören nach der Aufteilung das Landes in
ethnische Bevölkerungsgruppen zur Republika Srpska. Der
ehemaligen muslimischen Bevölkerung wird damit die
Rückkehr in ihre Heimat erschwert. Die Soldaten, die während
des Massakers in Srebrenica das Uno-Bataillon stellten,
waren Holländer. Für die niederländischen Politiker gab
es wegen des Nicht-Eingreifens ihrer Truppe noch ein
spätes Nachspiel. Die ausführlichen Untersuchungen zu
den Vorfällen (Niod-Bericht ) veranlassten im April 2002
Präsident Wim Kok zurückzutreten, um, wie Kok es
ausdrückte, ".die politische Mitverantwortung der
Niederlande am Massaker in Srebrenica sichtbar zu
machen." Die Soldaten seien auf eine unklare Mission in
eine ungenau definierte Schutzzone geschickt worden, "um
Frieden zu wahren, wo keiner war". Die Geschichte des im
Stück 11.Juli 1995 verwendeten Volksliedes Nizams
(Abschied) spiegelt etwas vom schwierigen Verhältnis
zwischen zwei Volksgruppen, die einst friedlich
miteinander lebten. Seit langer Zeit war die Melodie
des Liedes in Serbien bekannt und wurde dort so häufig
verwendet, dass man im ganzen Jugoslawien von einem
serbischen Lied sprach. - Vor 10 Jahren fanden
Musikethnologen heraus, dass es sich um ein sehr altes
Lied der spanischen Juden handelt, das mit diesen im
15.Jh nach Bosnien kam und von den bosnischen Muslimen
übernommen und mit einem Text versehen wurde. Heute hört
man das Lied in Bosnien sehr viel, in Serbien kaum noch.
B. Trakic
Die Gangster-Patrioten. Generalsekretär
Kofi Annan versucht die Untätigkeit der Vereinten
Nationen (z.B. im Bosnienkrieg) zu erklären: «Viele
unter uns glaubten, dass die Schrecken des Zweiten
Weltkrieges - die Todeslager, die Massenvernichtung,
der Holocaust - sich nie mehr wiederholen würden...
Aber die Geschichte hat uns gelehrt, dass die
Fähigkeit des Menschen, Böses zu tun, keine Grenzen
kennt.» (...)
Zu den schlimmsten Barbaren gehören Staatschefs und
Politiker, die - obschon sie in ihrem Land die
Legalität verkörpern - tagtäglich zahlreiche
Verbrechen begehen. Ihre kriminelle Energie steht
jener der Herren der internationalen Kartelle der
organisierten Kriminalität in keiner Weise nach. Auf
eigene Rechnung oder auf jene ihres Klans plündern sie
die Wirtschaft ihres Landes. Sie morden, foltern,
erpressen und erwerben gewaltige Vermögen, welche
meist auf diskreten Konten in Europa, häufig in der
Schweiz, landen. Diese Deliquenten -
Staatsoberhäupter, Führer politischer Parteien,
Regierungschefs, Generäle oder Minister - genießen
internationales Prestige, werden geehrt und umworben
von Journalisten, Diplomaten und Bankern. Sie sitzen
in der Generalversammlung der Vereinten Nationen,
halten Reden an die Welt, führen Verhandlungen und
schließen internationale Verträge ab. Wo immer sie
gehen, genießen sie die Privilegien und den Schutz,
die ihnen dank ihrer offiziellen Position im
Heimatstaat zustehen. Sie sind an der Macht dank
allgemeiner Wahlen oder, häufiger, dank eines
Staatsstreiches oder eines siegreichen Krieges. Im
Land, das sie beherrschen, verfügen sie meist über die
gesamte politische, militärische, ideologische und
finanzielle Macht... Allesamt sind sie Missetäter in
einem doppelten Sinn: einmal durch die strafrechtlich
relevanten Verbrechen - Mord, Totschlag, Folter,
Erpressung -, die sie begehen oder anordnen. Zum
anderen durch Verletzung des Völkerrechts, welche die
Plünderung von nationalen Ressourcen darstellt.
J. Ziegler, aus:
Die Barbaren kommen
Partitur ZU ERGÄNZEN
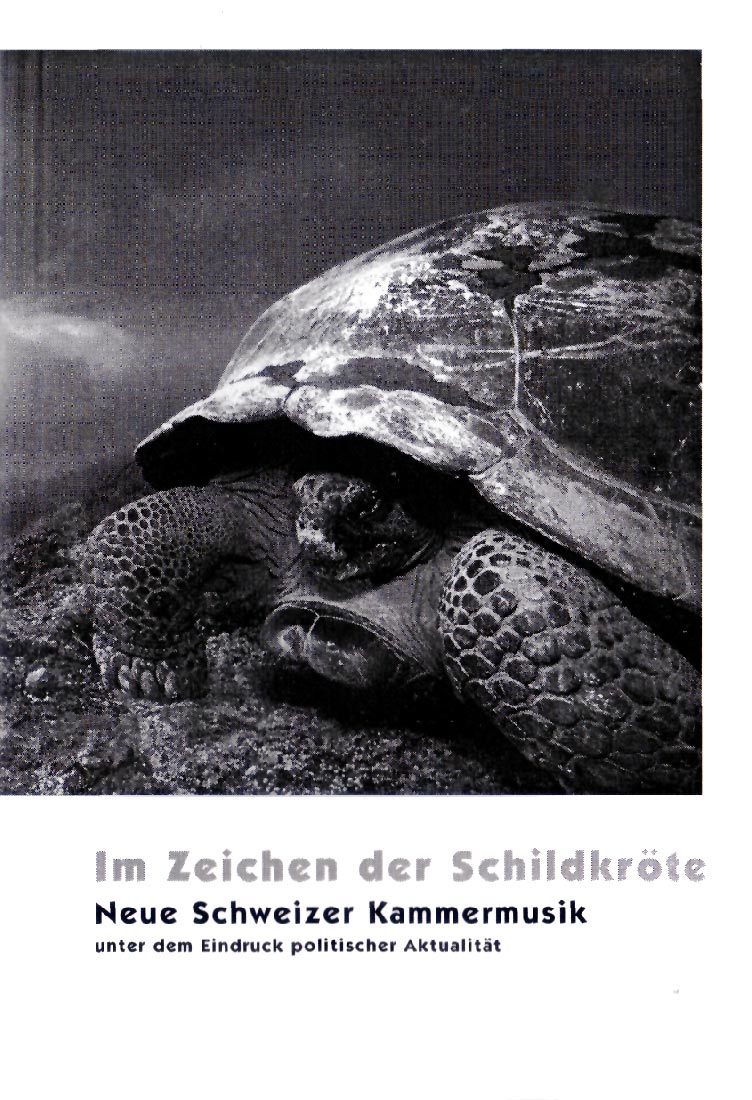
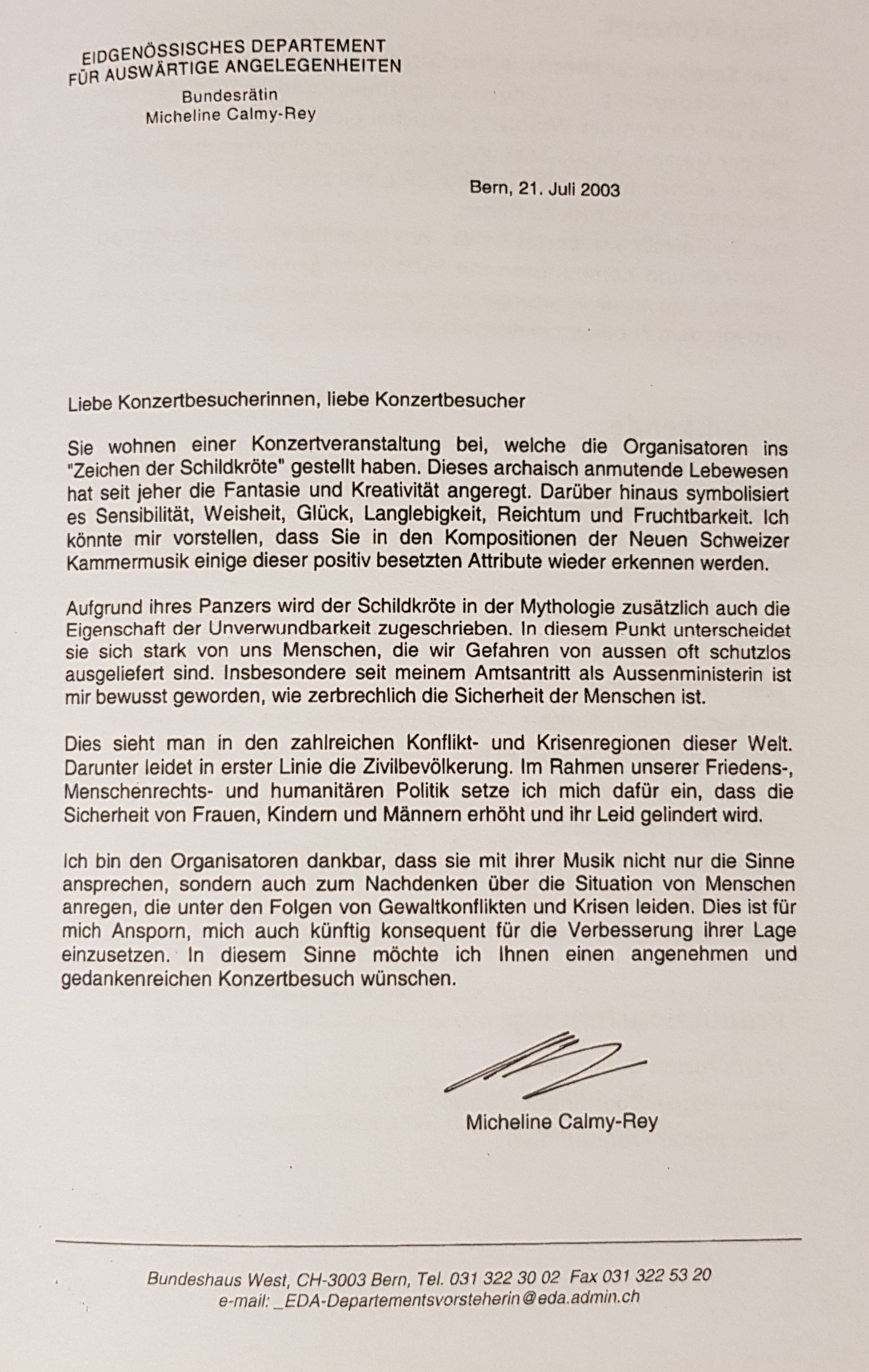
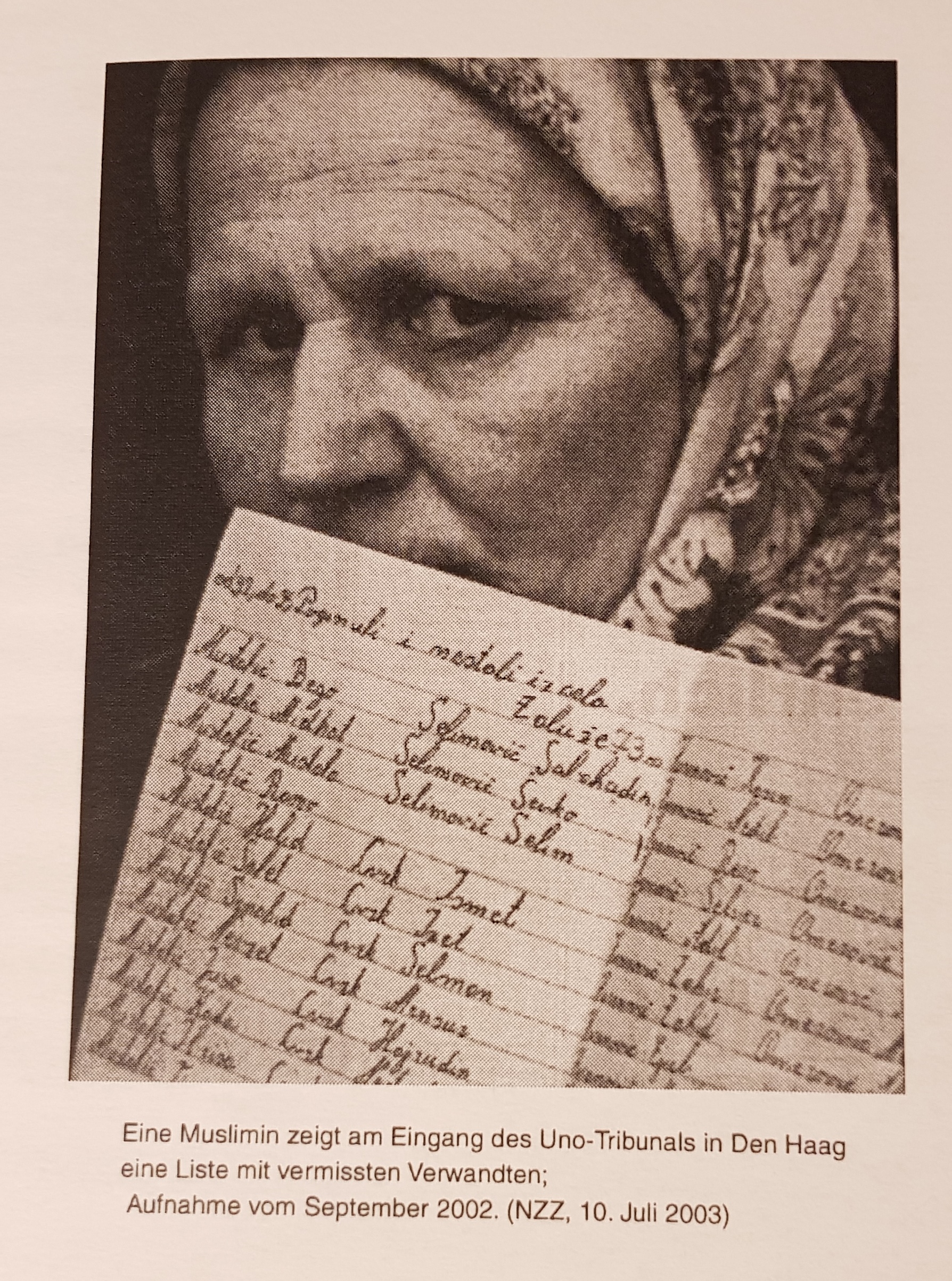
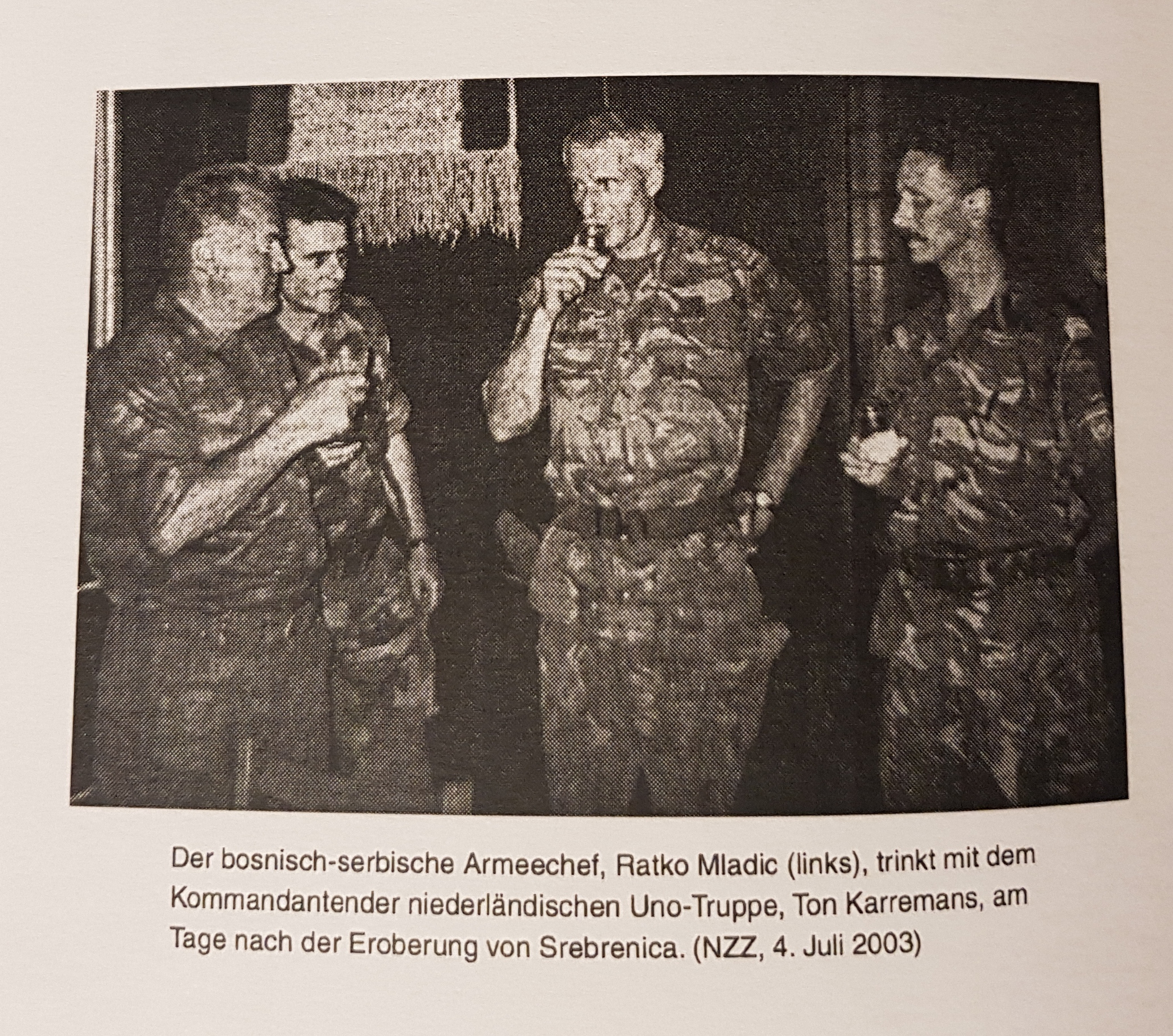
11. Juli 1995 - Einführung
Der Autor des Textes, Behaudin Trakic, lebt in Lukavac. Er
ist Bosnjake, Muslim und politischer Journalist. Während des
bosnischen Krieges war er als Waffenloser in verschiedenen
humanitären Aktionen eingesetzt.
Ich lernte ihn im Herbst 1995 in Zürich kennen, wo er seine
Frau und seine drei Söhne, die hier als Flüchtlinge lebten,
besuchte. Er war gezeichnet von seinen furchtbaren
Kriegserfahrungen.
Einer der schwersten Einsätze, sagte er, sei die Betreuung
der Flüchtlinge gewesen, die man nach dem Massaker von
Srebrenica zu Tausenden in Bussen und Lastwagen auf den
unbenutzten Flughafen von Tusla brachte. Die meisten hätten
unter Schock gestanden. Eine unheimliche Stille haber über dem
Platz gelegen. Neben der psychischen Belastung sei der Einsatz
bei den Helfern auch an die physische Leistungsgrenze
gegangen. Drei Tage und drei Nächte hätten sie ohne Schlaf und
Essen auskommen müssen. Als er sich endlich in eine Ecke hätte
zurückziehen können, sei ihm eine Szene aus dem Alten
Testament in den Sinn gekommen: 4. Mose 31, wo über die
Ausrottung der Midianiter und die Verteilung der Beute
berichtet wird. Genauso sei es in Tusla gewesen: nur alte
Männer, alte Frauen und Mütter mit Kindern seien aus den
Bussen gestiegen. Keine männlichen Wesen zwischen 12 und 60
und keine jungen Mädchen seien zu sehen gewesen.
Ich bat Behaudin, das Erlebte in einem Text zu formulieren,
damit ich meine Anteilnahme in meiner Sprache, der Musik, zum
Ausdruck bringen könne. "Ich kann nicht", sagte er immer
wieder; aber er hatte ein starkes Bedürfnis, den Schmerz durch
Aussprechen in den Griff zu bekommen, und schliesslich war der
folgende Text entstanden.
Jetzt war es an mir zu kapitulieren. Wie drückt man
"unheimliche Stille" in Tönen aus? Wie die "starren Kreise aus
Angst"? Ich dachte immer wieder, ich müsste aufgeben; aber
langsam begann ich Klänge zu hören, die sich zu einem
musikalischen Mosaik zusammenfügten, in dem der Text die
Dominanz behält und die Musik nur kommentiert.
Da gibt es z.B. die Journalisten mit ihren
Blitzlichtgewittern, die den Helfern mit ihrer herzlosen
Neugier auf die Nerven gehen und die allen mit ihren Kabeln im
Weg sind. Unser Elektroniker macht sie hörbar, zu sagen oder
zu singen haben sie nichts. Daneben ertönen die mit grosser
Emotion gesprochenen oder rezitierten Kommentare der
Sopranistin, die von tonmalerischen Figuren in der Violine,
dem Violoncello und dem Vibrafon unterstützt werden, und der
gefühlsstarke Gesang der Altistin, die uns alle um ein
tröstendes Wort bittet.
Der Mann, der "wie von Sinnen" (nicht "von Sinnen", sondern "wie
von Sinnen"!) den Moses zitiert, ist eine Kunstfigur, er kam
auf dem Flugplatz von Tusla nicht vor. Er ist sehr wichtig,
weil er das Geschehen in einen grösseren Zusammenhang stellt.
Ich habe ihn als einen sehr hoch und erregt singenden Altus
konzipiert. Das schreckliche Geschehen, welches die Angst der
Kinder erklärt, die Ermordung beider Eltern vor ihren Augen,
wird nicht in Worten, sondern im harten Trommelschlag des
Perkussionisten ausgesprochen. Für die Kinder spielt die
Blockflöte eine tröstende, kinderliedartige Melodie.
Das letzte Wort des Textes "Niemand kann mit solchen Bildern
leben" hat ein betrunkener Soldat, hier der Bariton. "Kinder
und Betrunkene sagen die Wahrheit", heisst es.
Mit solcher Härte kann das Stück aber nicht aufhören. Es
folgt noch das alte bosnische Volkslied "Nizamski rastanak",
Abschied. Es hat ebenfalls eine sehr traurige Aussage: ein
junger Soldat verabschiedet sich von seiner Mutter. Es ist
klar, dass er im Krieg sterben wird, aber sein Wunsch, noch
einmal alle Freuden seiner Heimat zu erleben, übergiesst die
Melodie mit einer sanften melancholischen Traurigkeit und hebt
sich deutlich von der analytischen Härte der modernen Klänge
ab. Das Lied wird vom Tenor (dem Altus von vorher) ohne jede
Begleitung auf bosnisch vorgetragen. In dieser
Schmucklosigkeit kommt seine tief empfundene Tragik am
stärksten zum Ausdruck.
Maria Porten, 19.6.2005

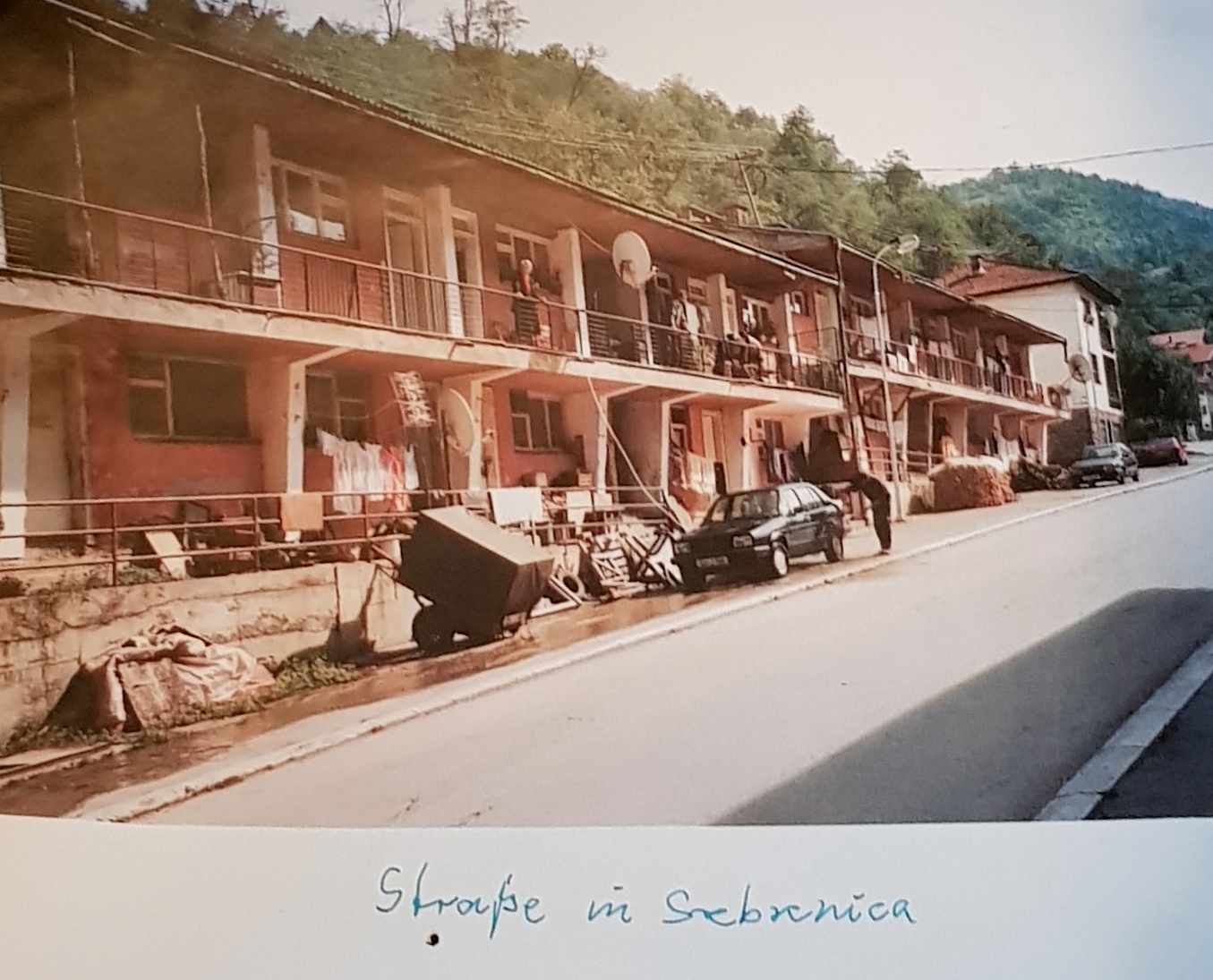

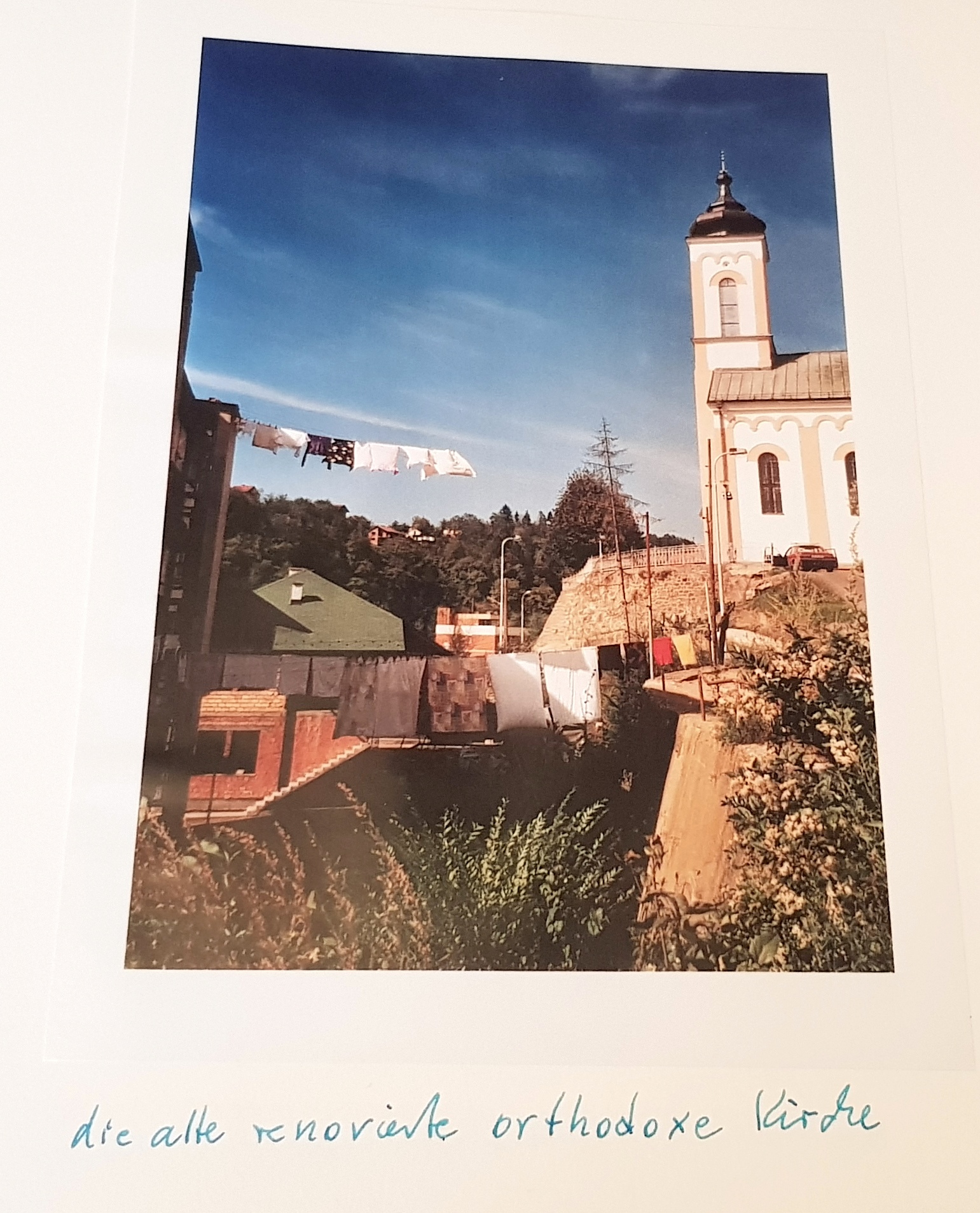

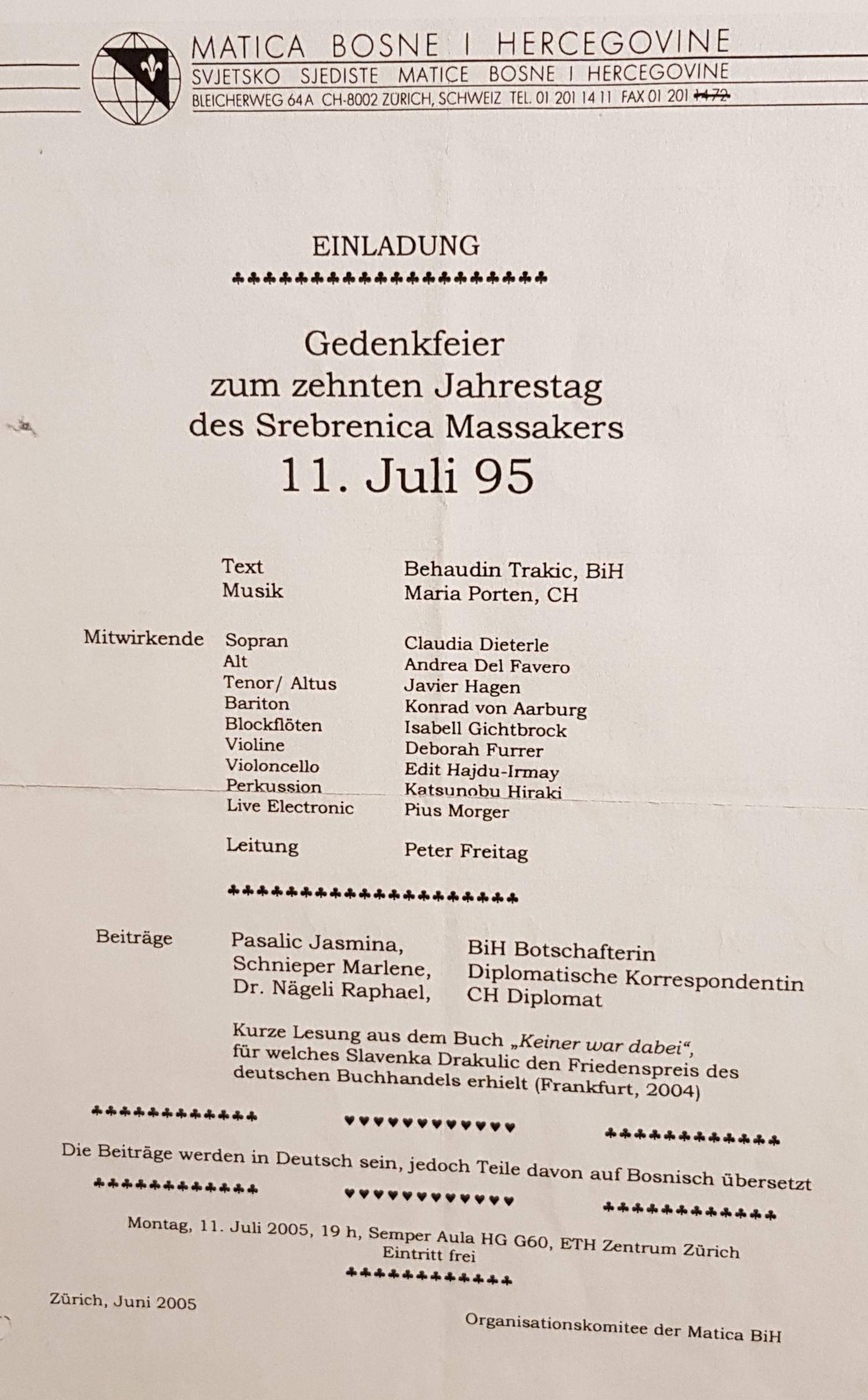
Einladung zur Gedenkfeier zum 10. Jahrestag
des Massakers von Srebrenica am 11. Juli 2005 in Zürich

Dr. Rustem Simitovic, Honorarkonsul von BiH in der Schweiz, übernahm das Patronat für die Aufführung von 2005 in Zürich
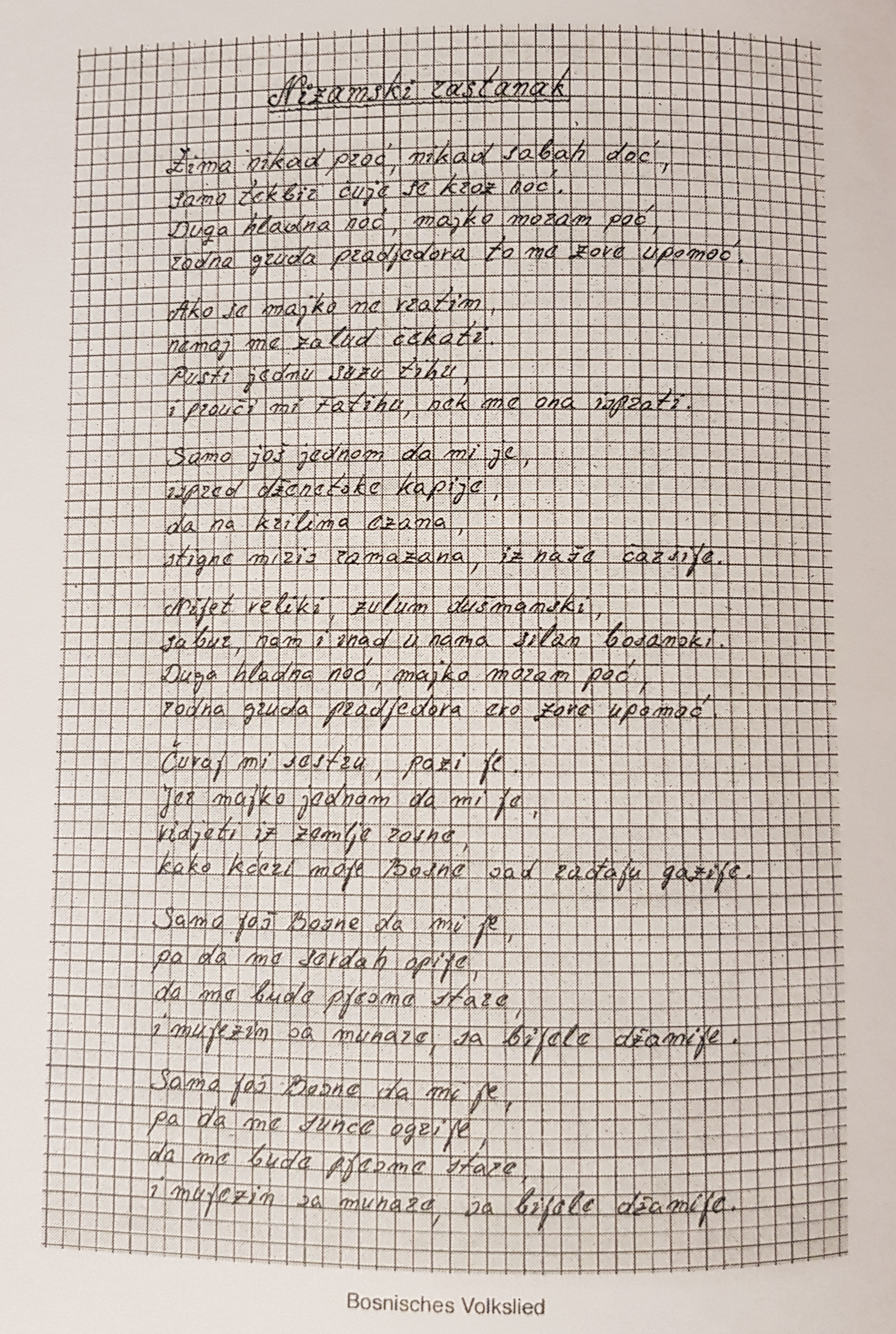
Nizamski rastanak, Handabschrift von Behaudin
Trakic